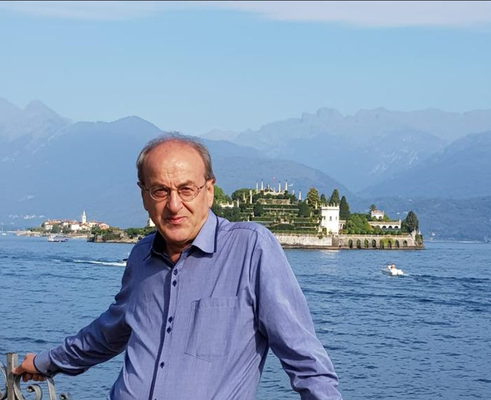Sein Vater arbeitete schon in der Schweiz. Seine Schwester und sein Bruder waren ebenfalls da tätig. So lag es nahe, dass auch er den Weg aus der Region Bergamo in die Schweiz unter die Füsse nahm. Seine erste Seelsorgestelle war in der Missione cattolica italiana (MCI) in Yverdon und Morges. Nach vier Jahren führte ihn der Weg von der West- in die Ostschweiz. Er wird Seelsorger in Herisau. Es folgen weitere Stationen. Seit dem 1. Januar ist er Koordinator der italienischsprachigen Seelsorge.
SKZ: Don Egidio, was sind Ihre Aufgaben als Koordinator?
Don Egidio Todeschini: Schlicht: Ich koordiniere die Seelsorge der Missione cattolica italiana (MCI). Dazu gehört, dass ich bei Vakanzen mögliche Seelsorger für die MCI dem Diözesanbischof vorstelle. Gleichzeitig habe ich Kontakt zum Bischof, aus dessen Diözese der Seelsorger kommt. Dann haben wir einen nationalen Rat. Dieser besteht aus sechs Personen und trifft sich alle zwei Monate. Diese Treffen bereite ich vor. Darüber hinaus besuche ich die einzelnen MCI und halte Kontakt zu den pensionierten Seelsorgern, die in der Schweiz bleiben. Ende 2020 veröffentlichte «migratio» das neue Gesamtkonzept «Auf dem Weg zu einer interkulturellen Pastoral – Migrationspastoral in der Schweiz.» Ich bin aktuell daran, einen Einführungskurs zu diesem neuen Konzept zu organisieren. Die Seelsorger der MCI, Referenten und Personen aus den Diözesen sind eingeladen. Mir ist das gemeinsame Gespräch wichtig. Wir wollen zusammenarbeiten.
Vermehrte Zusammenarbeit in Zukunft – wie entwickelten sich die MCI in den letzten Jahren?
Es gibt eine markante Entwicklung: 1998 gab es mehr als 80 Missionspfarreien in der Schweiz, jetzt sind es noch 42. Die Missionspfarreien wurden um fast die Hälfte reduziert. Ich gebe Ihnen ein Beispiel: Früher gab es im Kanton Luzern vier MCI – in Sursee, Hochdorf, Emmenbrücke und Luzern, heute gibt es nur noch einen Priester.
Welches sind die Gründe hierfür?
Es sind insbesondere drei Gründe: Erstens ist die Kirche in der Schweiz der Ansicht, dass die Italienerinnen und Italiener schon lange in der Schweiz und daher gut integriert sind und deshalb am Leben der Territorialpfarrei teilnehmen können. Zweitens spielen die Finanzen eine grosse Rolle. Der dritte Grund ist der Mangel an Priestern.
Wie reagieren die Gläubigen?
Sie sind sehr unzufrieden. Auch wurden sie nicht angehört. Die Mission war ihnen Heimat. Die Reduktionen setzen eine abwärtslaufende Spirale in Gang: Je mehr Missionen aufgelöst und auf einzelne wenige Zentren reduziert werden, desto weniger Gläubige kommen. Und das hat dann wiederum Auswirkungen auf die Finanzen. Wenn ich die Statistiken anschaue, dann sprechen sie für eine italienischsprachige Seelsorge. Allein im Bistum Basel gibt es im Jahr 2021 108 516 Einwohner mit nur einem italienischen Pass. Gegenüber 2020 nahm die Einwohnerzahl von Italienerinnen und Italienern um 32,75 Prozent zu. Hinzu kommen jene Italienerinnen und Italiener, die auch einen Schweizer Pass haben, diese sind hier nicht mitgezählt. Dieses Bild zeigt sich auch in den anderen Diözesen. Überall haben wir eine Zunahme.
Die Italienerinnen und Italiener, die als junge Erwachsene in den 50er- und 60er-Jahren in die Schweiz kamen, sind jetzt im hohen Alter. Welche Herausforderungen stellen sich da?
Das ist echt ein Problem. Wie halten wir Kontakt mit der älteren Generation, die nun im Alters- und Pflegeheim ist? In Städten mit einer hohen italienischsprachigen Bevölkerung gibt es Altersheime mit einer Abteilung für Italiener, so zum Beispiel in St. Gallen und Zürich. An anderen Orten haben wir den Besuchsdienst auf- und ausgebaut.
Was beobachten Sie bei der Zweit- und Drittgeneration?
Sie kommen in die MCI. Auch wenn nicht regelmässig, so treffe ich sie doch bei verschiedenen Gelegenheiten: bei der Ehevorbereitung, der Hochzeit, der Taufe ihrer Kinder, der Firmung und bei Beerdigungen. Die MCI ist auch für sie eine Art Zuhause. Denn die Missionspfarreien leben von Begegnungen und Gemeinschaft, von Festen und der Pflege der italienischen Kultur und Tradition. Sie sind für viele Italienerinnen und Italiener erste Anlaufstelle.
Interview: Maria Hässig