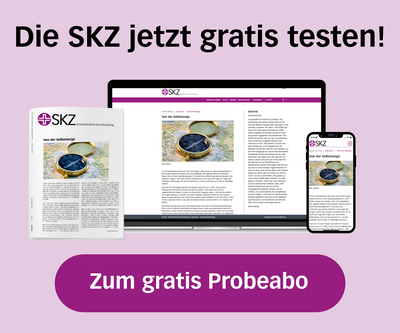Was wert ist
«Willkürlich ausgewählt» – so lautet die Bedeutung von «beliebig». Treffen Menschen die Wahl so willkürlich, wie die Bedeutung von beliebig suggeriert? Ursprünglich hatte «beliebig» die Bedeutungen von «angenehm, passend, erwünscht». Die heutige Bedeutung erhält es im Verlaufe des 18. Jahrhunderts in Anlehnung an das Substantiv «Belieben» – Neigung, Wille, Wunsch, Ermessen, Gutdünken. Ich wähle nach meiner Neigung, nach meinem Ermessen, nach dem, was mich gut dünkt. Meines Erachtens lautet die entscheidende Frage: Was ist wert, von mir gewählt zu werden? Im Blick auf das Leben: Dient meine Wahl dem Leben? Bringt sie es zum Wachsen, Blühen, Reifen? Dient meine Wahl dem Wohl der anderen Menschen? Fördert meine Wahl meine Entwicklung als Person? Denn, was ich wähle und entsprechend umsetze, das wird ein Teil meiner Lebensgeschichte, es wird ein Teil von mir. Ich entwickle mich in die Richtung meiner Entscheidungen. Nach Viktor E. Frankl ist der Mensch «das Wesen, das in jedem Augenblick entscheidet, was es im nächsten Augenblick sein wird». Wie will ich morgen und übermorgen sein? Glücklich, unzufrieden, egoistisch, gütig, versöhnt, verbittert, fröhlich, friedvoll … Ich kann heute die Weichen dafür stellen. Und nebenbei: Glück und Freude stellen sich als Nebeneffekt einer Tat zum Wohl des Lebens, des Nächsten und für mich selbst.
Maria Hässig