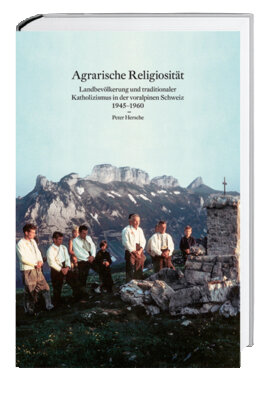Ein brisanter Rückblick auf eine nahe Vergangenheit, die fern ist
Gibt es sie noch – die Volksfrömmigkeit? Gewiss, in einigen Formen, etwa den Wallfahrten, in einigen Zeichen, etwa Wegkreuzen, in einigen Gebeten, etwa da und dort dem Rosenkranz. Aber wer nach 1960 geboren ist, kann keine Ahnung haben vom Reichtum der volksfrommen Äusserungen, die das kirchliche Leben bis über die Mitte des 20. Jahrhunderts geprägt und umrahmt und manchmal durchwuchert haben. Hat es einen Sinn, sich mit diesen abgestorbenen oder absterbenden Formen überhaupt noch zu befassen? O ja, denn ihr Entstehen, Blühen und Absterben ist Ausdruck umwälzender geschichtlicher Ereignisse; ihre Wechselwirkung zu ergründen, ist höchst aktuell. Eine Neuerscheinung verhilft dazu, dies an ganz konkreten Erscheinungen nachzuvollziehen.
Agrarische Religiosität
Das Buch,1 dem dieser Beitrag gilt, untersucht, wie der Untertitel sagt: «Landbevölkerung und traditionaler Katholizismus in der voralpinen Schweiz 1945–1960». Die Beschränkung auf einen bestimmten Bevölkerungssektor, eine bestimmte Sorte von Religiosität und einen recht kurzen Zeitraum ist nicht Ausdruck einer Verlegenheit oder Selbstbeschränkung, denn anhand dieses Ausschnitts können ganz grundsätzliche Fragen aufgeworfen und in einen grösseren Zusammenhang gestellt werden. Das besorgt der Verfasser, Peter Hersche (*1941), emeritierter Professor für Geschichte an der Universität Bern. Er hat in früheren Studien ein umfassendes Werk in zwei Bänden über europäische Gesellschaft und Kultur im Barockzeitalter unter dem wegleitenden Titel «Musse und Verschwendung» (2006; vgl. die Buchanzeige in SKZ 177 [2009], Nr. 27–28, S. 473) veröffentlicht und ihm eine kürzere Darstellung «Gelassenheit und Lebensfreude. Was wir vom Barock lernen können » (2011; vgl. die Buchanzeige in SKZ 179 [2011], Nr. 31–32, S. 493 f.) folgen lassen. Die beiden Titel heben wesentliche Aspekte dieses Zeitalters hervor, die gerade in agrarischen Welten bis nach 1950 wirksam waren und durchaus nicht altes Gerümpel sind, sondern Spiegel der Selbsteinsicht werden könnten.
Mit der «voralpinen Schweiz sind genauer die (katholischen) Appenzell-Innerrhoden und Obwalden gemeint, mit Ausblicken auf die benachbarten (protestantischen) Ausserrhoden und Berner Oberland (und bisweilen auch weiter), in denen der primäre Sektor um 1950 noch zu 50 oder 40 Prozent vorherrschend war. Eine relative Abgeschlossenheit (vor der endgültigen Erschliessung durch den Tourismus) und eine altüberlieferte politische Struktur förderten eine Beharrlichkeit im Lebensstil, in der Denk- und Fühlweise, in der Religiosität. Der Innerhödler Landammann präsidierte die Landsgemeinde, den Grossen Rat und die Regierung und «hatte also beinahe die Machtfülle eines früheren absoluten Fürsten» (S. 38). «Grasbau und Milchwirtschaft herrschen bis heute vor» (S. 32), Alpwirtschaft ergänzte die Talbetriebe, Hühner waren überall vorhanden, das nötigste Handwerk kam vor, in Appenzell als Heimarbeit die Handstickerei und etwas Kunsthandwerk, in Obwalden spielte teilweise auch der Feldobstbau eine Rolle.
Der kenntnisreiche Verfasser, der vom 17. und 18. Jahrhundert an das «Barockzeitalter» in seinen Ausläufern bis heute verfolgte, stellt eine Menge von Überlieferungen fest (darum «traditionaler Katholizismus »), die sich kontinuierlich durchzogen, aber in allerkürzerster Zeit weitgehend verschwunden sind. Voreilige Analytiker wollen «das Konzil» dafür verantwortlich machen, aber dieses ist nicht (alleinige) Ursache des Problems, sondern Teil einer weltweiten Problematik, die es natürlich im kirchlichen Bereich verstärkt hat. Der enge Zusammenhang der Feiertage im Zyklus eines agro-liturgischen Jahres konnte (auf S. 350) schematisch dargestellt werden. Es wird klar, wie eine marxistische Deutung (wie sie etwa in der deutschen Volkskunde um 1970 im Schwang war) danebengreift: Nicht das «Sein» (die wirtschaftlichen, sozialen, politischen Verhältnisse) prägt das «Bewusstsein» (die Ideologie, Weltanschauung) des Volkes, sondern es findet eine Wechselwirkung zwischen Mentalität und Arbeitswelt statt.
Zielsetzung, Methode und Ergebnisse
Peter Hersche wollte weder einen Beitrag zur institutionenbezogenen Kirchengeschichte noch zur Beschreibung herausragender Anlässe und Festzeiten liefern, sondern die Alltagsfrömmigkeit des gewöhnlichen Volkes darstellen, und zwar, wie sie aus der Erinnerung der noch lebenden (heute recht alten) Zeitgenossen jener Epoche noch zu erfragen ist. Er weiss natürlich genau, dass alle Erinnerungen selektiv und gefärbt sind und dass es keine «Wirklichkeit an sich» gibt, sondern nur interpretierte Wirklichkeit. Aber eine behutsame Fragemethode bei je ca. 20 Personen beider Geschlechter mit nachträglichen Kontrollen und Beizug von Archivalien und anderen schriftlichen Dokumenten bietet Gewähr für eine wirklichkeitsnahe Beschreibung. Hervorzuheben ist die diskrete (und doch recht ertragreiche) Zurückhaltung in heiklen Fragen (soziale und familiäre Verhältnisse, Sexualität), die vorurteilslose Darstellung von Denk- und Verhaltensweisen, die heute hie und da merkwürdig anmuten könnten, die aber in ihrem Kulturmilieu durchaus adäquat und auch wirksam waren. Der Vergleich der registrierten und protokollierten Interviews (im Buch aus verständlichen Gründen anonymisiert) untereinander, aber auch etwa mit den Erfahrungen des fast gleichaltrigen Rezensenten aus seiner Heimatpfarrei in der Stadt St. Gallen zeigt, dass die Ergebnisse tragfähig und aufschlussreich sind. Hier können nur wenige Beispiele gebracht werden.
Klerus und Volk
In beiden Kantonen, aber in Innerrhoden noch ausgeprägter, zeigt sich eine bemerkenswerte Selbstständigkeit der Bevölkerung gegenüber dem Klerus. Der geringere Teil stammte aus den eigenen Landen, die anderen trafen nicht immer «den Ton», ihre Vertreter schwanken zwischen übertriebener Strenge, ja Barschheit und Herrschsucht einerseits und Grosszügigkeit oder schwankender Anpassung andererseits. Mit der Beichte hatte die Geistlichkeit ein umfassendes Kontrollsystem über die ganze Gesellschaft, dem aber viele Gläubige geschickt auswichen, entweder in die Nachbarpfarrei oder zu den beliebten Ordensleuten, Benediktinern in Engelberg und v. a. Kapuzinern in Appenzell und Sarnen. Diese standen mit dem Volk in engstem Kontakt, und die Beliebtheit beschränkte sich beileibe nicht auf Katholiken. Um die Kapuziner rankte sich eine üppige Voksfrömmigkeit, die Peter Hersche oft erwähnt und der der Rezensent 1972 eine eigene, versteckt «veröffentlichte» Studie gewidmet hat. Diese Sorte von Religiosität geriet in der Nachkriegszeit und durch die folgenden gesellschaftlichen Veränderungen in eine tiefe Krise, v. a. bei den Kapuzinern selbst; sie wurde nach Möglichkeit in konzilskonformere Praktiken umgeleitet oder schlicht aufgegeben. Wirksam waren auch die weiblichen Orden und Kongregationen mit ihren Niederlassungen und die Tätigkeit im Schulwesen.
Nebeneffekte kirchlicher Handlungen
Offiziell sind kirchliche Handlungen auf die Ehre Gottes und das Heil der Menschen ausgerichtet. Aber die Messe, v. a. am Sonntag, im Advent oder am Patronatsfest, die Prozessionen, die Wallfahrten, die Andachten v. a. im Mai hatten durchaus erwünschte Nebeneffekte: Sie waren herausragende Möglichkeiten zur Kommunikation, die bei der Streusiedlung sonst eher zu kurz kam. So traf man sich denn nach der Messe in der Wirtschaft (und manchmal schon während der Messe oder der oft langen Predigt), die Jugend konnte auf dem Kirchgang und vor und nach den Gottesdiensten sich begegnen, die Frauen kamen aus dem Haushalt und der Mithilfe im Betrieb etwas heraus. Die Gottesdienstzeiten mussten sich den Gegebenheiten der Landwirtschaft anpassen: Der Arbeitsalltag dauerte intensiv von 5 bis 10 und dann wieder von 16 bis 20 Uhr (ungefähr), dazwischen gab es Zeiten der Musse, bei Tabak und Zeitung oder Kalender oder bei weniger intensiver Tätigkeit.
Die kirchlichen Anlässe gaben auch die Möglichkeit, den ästhetischen Sinn zu entfalten, der überhaupt diese Kultur kennzeichnet – Kuhkauf und -verkauf war Anlass zu schön herausgeputztem Vieh und Zeichen von Reputation –; an Fronleichnam glänzte das ganze Dorf. Wenn aber etwa die reichen Blumenteppiche vor den Altären usw. heute verschwunden sind, ist weniger ein böser Zeitgeist daran schuld als die schlichte Tatsache, dass es keine Blumenwiesen mehr gibt, die eben auch keine Wiesenblumen mehr bereitstellen! Und die Wallfahrten, früher noch mehr zu Fuss, boten auch Gelegenheit zum geselligen Austausch und für eine körperliche Leistung.
Sexualität und Moral allgemein
Der Autor hat in diesem Thema bewusst nicht neugierig herumgebohrt, aber es kamen genügend Indizien dafür zu Tage, dass zwischen der Norm der Kirche und dem faktischen Verhalten oft deutliche Unterschiede vorlagen. Der Klerus war auf die möglichen Gefahren fixiert und hämmerte die Vorsichtsmassnahmen ein, die Eltern waren oft nachsichtiger und liessen den Heranwachsenden gewisse Freiheiten – und nahmen sie auch in Anspruch. Wie wenig Feingefühl der Klerus manchmal in diesem Gebiet aufwies, wurde immer wieder erwähnt (öffentliche Blossstellung von «Abweichlern», Kampagnen gegen «unzüchtige» Kleidung oder «gemischtes Bad», Herablassung oder Beschimpfung). Allerdings liessen gerade die Appenzeller das nicht immer auf sich sitzen, sie setzten sich mit ihrem berühmten Witz darüber hinweg oder machten alle Anstrengungen, ihre unbeliebten Geistlichen loszuwerden.
Dass etwa in einem Kapuzinerkloster ein gelehrter Mitbruder in den Vierzigerjahren verschwand, um zu heiraten, wirbelte weithin ungeheuer Staub auf – die Klosterchronik verzeichnete den Vorfall jedoch nicht (wohl aber, wenn der zuständige Bischof zum Mittagessen kam), so dass er sogar nicht in die Geschichtsschreibung gelangte. Hier ist er historisch festgehalten, zumal gleichzeitig mit ihm ein beliebter Kaplan den gleichen Schritt tat. – Anderseits half eine ausgedehnte Caritas ein wenig über soziale Ungleichheiten hinweg, Sparsamkeit war angezeigt, Trunksucht verpönt (aber vereinzelt natürlich doch vorkommend, manchmal in heiterer Weise), Nachbarschaftshilfe selbstverständlich, Mesner und Pfarrköchin bildeten oft die Brücke zwischen Klerus und Volk, im Stillen geschah viel Gutes.
Unterschiede und Ähnlichkeiten
Die konfessionellen Verschiedenheiten wurden zwar vom Klerus betont, aber im Alltag wogen sie nicht so schwer – die Lebensumstände waren allzu ähnlich, und wenn auch die Protestanten gemäss ihrem Arbeitsethos «hablicher» sein konnten, so genossen doch die Katholiken ihre wenigen Freiheiten ausgiebig, Tanz und Musik hatten einen hohen Wert. Doch der sozial-ökonomische Wandel seit der Mitte des 20. Jahrhunderts traf alle: «Renditedenken, Zeitdisziplin, Rationalisierung, Versicherung, landwirtschaftliche Bildung, Mechanisierung usw.» (S. 356) standen einer barocken Mentalität von Musse und Verschwendung, Gelassenheit und Lebensfreude entgegen. Auch zwischen den beiden Hauptuntersuchungsgebieten gab es topografische, soziale, wirtschaftliche und historische Unterschiede (Obwalden war mehr «römisch-gesamtschweizerisch», Innerrhoden mehr partikulär ausgerichtet), aber der voralpine Charakter war beiden eigen. Das «pianische Jahrhundert» (von Pius IX. ab 1846) bis und mit Pius XII. (bis 1958) prägte diszipliniert die gesamte katholische Welt recht einheitlich, in der Schweiz konfrontiert mit jahrhundertealten demokratischen Überzeugungen. Unterschiedlich auch die schwankende Gemütslage in Appenzell-Innerrhoden gegenüber einer grösseren Ausgeglichenheit in Obwalden.
Gesamthaft muss man aber feststellen, dass zwei «traditionale Welten», Landwirtschaft und Religion, im Übergang begriffen sind. Ob dies aber Verschwinden oder Wandel bedeutet, hängt von der nüchternen Feststellung der Gegebenheiten und der planenden Voraussicht in beiden Bereichen ab. 1945 war die Landwirtschaft noch näher dem Mittelalter als dem Jahre 2000 (S. 384), Hersche spricht von einer «agrarischen Revolution» – das dürfte auch vom Christentum (jedenfalls bei uns) gelten.
Kontinuität oder Bruch?
Seit einiger Zeit wogt die Diskussion darüber, ob das Zweite Vatikanische Konzil in Kontinuität zur Vergangenheit stehe oder einen (unumkehrbaren?) Bruch eingeleitet habe. Besser würde man darüber diskutieren (und nachdenken), was mit der Gesamtgesellschaft geschehen ist und geschieht. Das Christentum, und hier besonders der Katholizismus, ist eine weltumspannende, historisch gewachsene und darum dem ständigen Wandel unterworfene gesellschaftlich- kulturelle Erscheinung mit vielen Facetten. Das Buch von Hersche schildert das mit aller wünschenswerten Genauigkeit an einem kleinen Ausschnitt, dafür lebensnah – und übertragbar auf analoge Geschehnisse.
Von der theologischen Seite her hat wohl der französische Jesuit Michel de Certeau (1924–1986) die Sachlage am gründlichsten durchdacht und sie in vielen Sparten durchexerziert: Mystik, Besessenheit, 1968er-Bewegung, Anthropologie, Sprachwissenschaft, Befreiungstheologie, Psychoanalyse usw. Was uns heute umtreibt, hat er vor Jahrzehnten geahnt und analysiert. Er macht mit seiner Geschichtstheologie eher Mut gegenüber dem weit verbreiteten Pessimismus, gerade in kirchlichen Kreisen. Die eine Person Jesus Christus hat durch ihren Weggang einer Vielzahl von Deutungen ihrer Botschaft Platz gemacht, die miteinander im Gespräch bleiben müssen. Eine einzige gültige kompakte Lehre ist nicht vorgesehen, das Gespräch ist gefordert, nicht Befehl und Gehorsam. Die Einsicht, dass das «Alte» überholt ist, erlaubt nicht, es auszublenden, es ist und bleibt der Ursprung des Heutigen und Künftigen.
Darum braucht es immer wieder eine «rupture instauratrice» (einen Abbruch, der Neues hervortreibt) und eine «fidélité créatrice» (eine schöpferische Treue); de Certeau sucht für die Theologie ein «ailleurs» (ein Anderswo), nämlich im Menschen, wo sich die Botschaft verwirklichen muss und wo es nicht beim «dire» (Sagen) bleiben darf (man denke an die Flut der kirchenobrigkeitlichen Verlautbarungen, sondern sich im «faire» (Tun) bewähren muss. Der Eine Gott («singularité») muss in Vielfalt («pluralité ») zugänglich werden. Theologie wird Begegnung zwischen «logos» (Vernunft, Verstand, Wissenschaft, Diskurs) und «kairos» (Ereignis, Andersheit, Überraschung des Unvorhergesehenen). Kirche geschieht so nicht primär in Entscheidungsräumen (einzelner Menschen oder mehrerer), mit Weisungen an die Untergebenen. Dann wird es nicht mehr möglich, dass nach dem Wegfall der Einzelbeichte die gut eingebürgerte gemeinschaftliche Bussandacht kirchenamtlich zerstört wird, der Zölibat disziplinarisch an das Priesteramt gekoppelt bleibt usw.
Peter Hersche hat mit seiner kultur- und sozialgeschichtlichen Studie, die an die entschwundene «Religiöse Volkskunde» anknüpft, nach jahrelanger Vorarbeit eine Zeitanalyse gewagt, die eigentlich Pflichtlektüre an den theologischen Fakultäten und bei allen Kirchenverantwortlichen werden könnte. Das Buch ist drucktechnisch hervorragend aufgemacht und mit allen wünschenswerten Angaben in Anmerkungen, Bibliografie und Quellenverzeichnis versehen.
Dr. Iso Baumer, geboren 1929 in St. Gallen, studierte Sprach- und Literaturwissenschaft und war als Gymnasiallehrer in Bern und Lehrbeauftragter für Ostkirchenkunde an der Universität Freiburg (Schweiz) tätig. Er wandte sich zunächst der Religiösen Volkskunde zu und publizierte u. a. zwei Bände über die Wallfahrt zu U. L . Frau von der Vorburg bei Delsberg und eine wissenschaftstheoretische Studie über das Wallfahren allgemein. Nach 1980 wandte er sich der Ostkirchenkunde zu und dozierte in Freiburg i. Ü. und Einsiedeln; er veröffentlichte u. a. «Tradition im Wandel. Beiträge zur italienischen Volkskunde» (1967), «Le pèlerinage au Vorbourg» I und II (1976 und 1984), «Wallfahrt als Handlungsspiel. Ein Beitrag zum Verständnis religiösen Handelns» (1977). Weitere Bände und viele kleinere Studien folgten über die Ostkirche(n), einer über einen armenischen Kirchenschriftsteller aus dem 12. Jahrhundert erschien im J uni 2013: Nerses von Lambron. Die Ungeduld der Liebe. Zur Situation der christlichen Kirchen. (Paulinus-Verlag) Trier 2013.