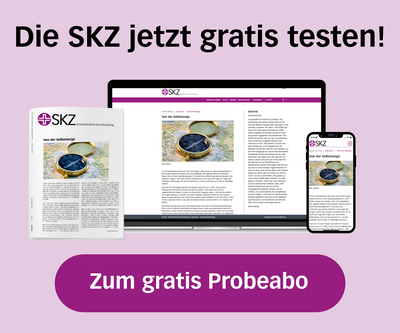«Macht hoch die Tür, die Tor macht weit» – dieses Lied begleitet uns durch den Advent auf Weihnachten hin. Ich verbinde es mit dem Wunsch, dass ich meine Herzenstür offen halte für andere Menschen, auch für jene, die mir «nicht in den Kram passen»; dass wir als Kirche zugänglich bleiben für die Freuden und Sorgen von anderen; und dass die Tür zum Frieden nicht zugeschlagen wird.Gewiss sind Türen auch ein Schutz. Sie teilen innen und aussen und schützen die Privatsphäre. Nicht alles ist für den Marktplatz bestimmt. Zu Recht reagieren wir sensibel, wenn Grenzen überschritten werden. Zum Glück dürfen wir Türen zumachen.
«Macht hoch die Tür, die Tor macht weit.» Türen, die geöffnet sind, ermöglichen den Austausch von Gütern und Gutem zwischen den Menschen. Manchmal aber gleichen unsere Diskussionen jenen um Strafzölle, die wir in der Weltpolitik im Moment erleben: Wenn ihr uns das nicht gebt, dann …! Selig sind, die Brücken bauen und Türen offen halten!
In meinen ersten Monaten als zwölfter Bischof von St. Gallen begegnete ich vielen Menschen. Meistens ist es gelungen, einen Zugang zueinanderzufinden. Das erfüllt mich mit Hoffnung auch für das neue Jahr und für die anspruchsvollen Themen, an denen wir arbeiten. Wie können Synodalität und Partizipation unser Kirchesein noch mehr inspirieren? Wie bleibt die Kirche auch mit weniger Ressourcen präsent, wo Menschen sie suchen, und wie gestalten wir starke Orte? Wie bauen wir das Vertrauen wieder auf, wo es in der Zusammenarbeit gelitten hat? Wie sind wir mit der christlichen Botschaft offen und mutig präsent in einer Gesellschaft, die sich weiter säkularisiert?
Für meine erste Weihnachtskarte als Bischof habe ich ein Bild aus der Mauritius-Rotunde in Konstanz ausgewählt. Die Bildergeschichte rund um das Heilige Grab (aus der Zeit um 1260) beginnt mit der Verkündigung, der Begegnung zwischen dem Erzengel Gabriel und Maria. Mit ganzem Einsatz, mit seinem offenen und heiteren Gesicht wirbt Gabriel für die Frohe Botschaft. Maria scheint zuerst wenig begeistert. Sie hebt abwehrend die Hand. Beim nächsten «Bild» der Rotunde sieht man, wie sie nun selbst mit charmantem Gesicht bei Elisabeth anwirbt. Ja, so kann es gehen!
Schliesslich erinnert mich Weihnachten an Gottes Charmeoffensive. Gott wirbt mit ganzem Einsatz, mit seinem offenen und heiteren Gesicht für sein Wort. Sein ewiges Wort wird Mensch, bekommt Hand und Fuss – selbst im besetzten Land. Vielleicht heben auch wir da manchmal abwehrend die Hand – aus Angst, aus Überforderung, aus Bequemlichkeit. Aber beim nächsten Bild kann es schon anders sein. Gott sei Dank!
Herzlich danke ich allen, die sich für offene Türen, für den Dialog, für das Miteinander in der Kirche und in der Gesellschaft einsetzen. Ihr seid es, die die Sache weiterbringt. Ihr seid die «Menschen guten Willens», von denen die Engel in der Weihnachtsnacht singen.
+ Beat Grögli, Bischof von St. Gallen*